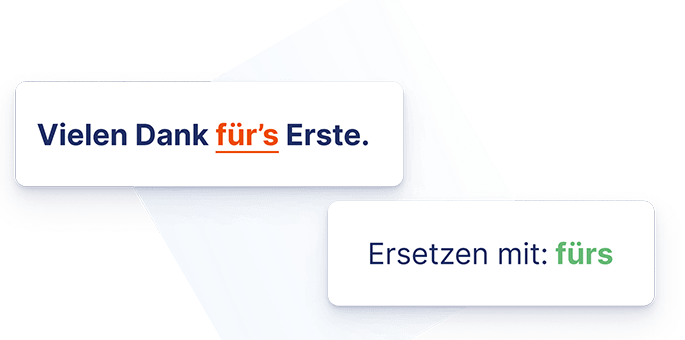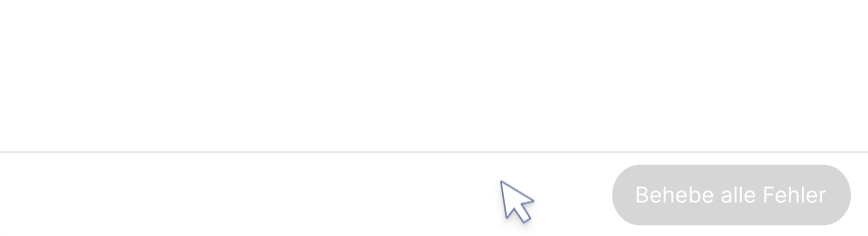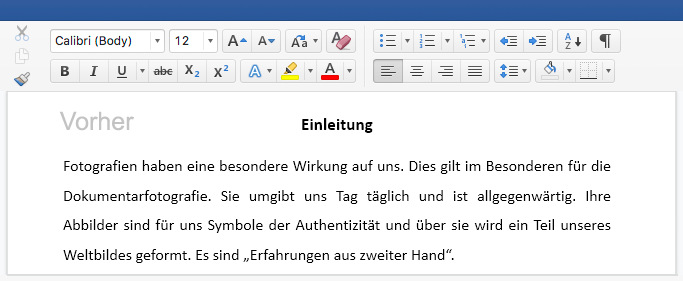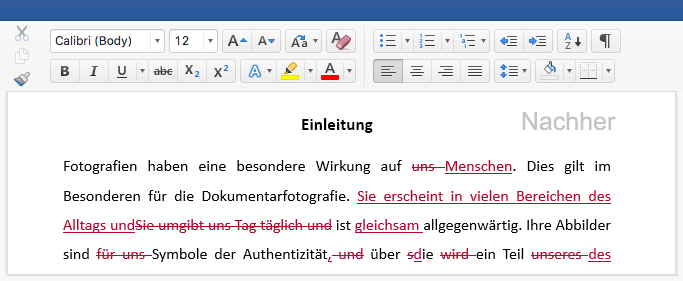Zeitformen in wissenschaftlichen Arbeiten
Der Großteil einer wissenschaftlichen Arbeit wird im Präsens verfasst, bei manchen Ausführungen greift man jedoch auf das Perfekt oder das Präteritum zurück.
In den verschiedenen Teilen einer Abschlussarbeit Abstract, Einleitung, Theorie, Literaturübersicht, Methode, Ergebnisse und Fazit bzw. Ausblick werden teilweise unterschiedliche Zeitformen verwendet.
Abstract oder Zusammenfassung
Präsens: Für allgemeine Fakten und um das Thema der Arbeit zu umreißen, z. B.:
Perfekt: Für vergangene Ereignisse, z. B.:
Einleitung
Präsens: Bei der Beschreibung des Ausgangspunkts der Arbeit, des Forschungsstandes im Gebiet der Arbeit und des Ziels, z. B.:
Perfekt: Um den historischen Hintergrund darzustellen, z. B.:
Theoretischer Teil
Präsens: Bei dem Verweis auf publiziertes Wissen und bei Definitionen, z. B.:
Perfekt oder Präteritum: Bei expliziten Verweisen auf Erfindungen/Schöpfungen anderer, z. B.:
Literaturübersicht
Präsens: Um gegenwärtiges Wissen oder Informationen mit allgemeiner Gültigkeit wiederzugeben, z. B.:
Präteritum: Um zu beschreiben, was eine bestimmte Person tat oder herausfand, z. B.:
Material- oder Methodenteil
Präsens: Bei der Beschreibung des Untersuchungsgebietes (da es ja immer noch besteht) und beim Verweis auf bekannte Methoden und Verfahrensweisen (= publiziertes Wissen), z. B.:
Perfekt oder Präteritum: Bei der Beschreibung der tatsächlich durchgeführten Arbeitsschritte, z. B.:
An der Untersuchung haben insgesamt 50 Personen teilgenommen.
Ergebnisteil
Perfekt oder Präteritum: Bei der Darlegung der Forschungsergebnisse, z. B.:
Die Befragung hat ergeben, dass sich Studierende mehr finanzielle Unterstützung von ihren Eltern wünschen würden.
Fazit oder Diskussion
Präsens: Für die Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse, z. B.:
Präteritum oder Perfekt: nur, wenn man sich auf die Ergebnisse bezieht (vgl. Ergebnisteil)
Nicht empfohlen: Historisches Präsens
Sonderfall: Mit dem historischen Präsens werden vergangene Ereignisse im erzählerischen Ton in der Gegenwartsform wiedergegeben. Dies kann Lesenden ermöglichen, sich besser in das Geschehene hereinzuversetzen.
Für wissenschaftliche Arbeiten ist dieser Stil jedoch nicht geeignet. Stattdessen sollten Präteritum oder Perfekt verwendet werden.
Diesen Scribbr-Artikel zitieren
Wenn du diese Quelle zitieren möchtest, kannst du die Quellenangabe kopieren und einfügen oder auf die Schaltfläche „Diesen Artikel zitieren“ klicken, um die Quellenangabe automatisch zu unserem kostenlosen Zitier-Generator hinzuzufügen.
Korath, D. (2023, 16. Oktober). Zeitformen in wissenschaftlichen Arbeiten. Scribbr. Abgerufen am 2. Juli 2025, von https://www.scribbr.de/wissenschaftliches-schreiben/zeitformen-in-wissenschaftlichen-arbeiten/