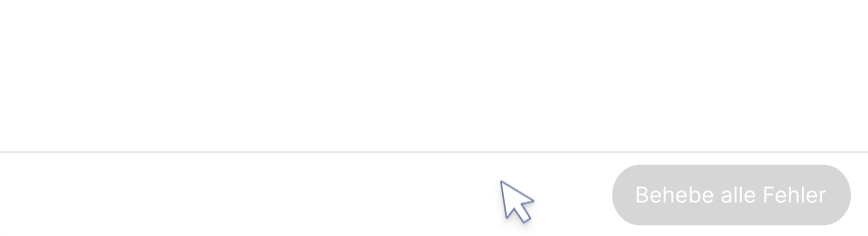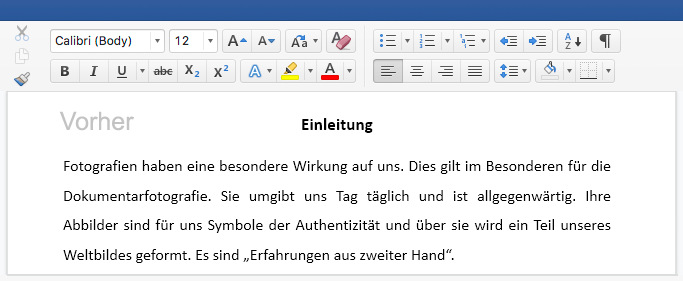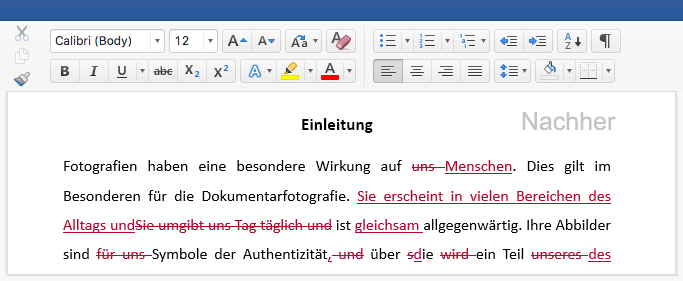Hypothesen aufstellen mit Beispielen für die Abschlussarbeit
Eine Hypothese ist eine Annahme bzw. eine Vermutung über einen Zusammenhang.
Hypothesen stellst du zu Beginn deiner Abschlussarbeit auf und prüfst sie mittels empirischer Forschung.
Das ist eine Hypothese
Eine Hypothese drückt in der Regel den vermuteten Zusammenhang zwischen zwei Sachverhalten aus. Sie ist die provisorische Antwort auf eine wissenschaftliche Problemstellung.
Hypothesen sind kein fester Bestandteil wissenschaftlicher Arbeiten. Jede Abschlussarbeit benötigt eine Forschungsfrage, während Hypothesen jedoch nur benötigt werden, wenn du deine eigene empirische Forschung durchführst.
Eine Hypothese besteht aus einer unabhängigen Variablen – die Ursache – und einer abhängigen Variable – die vermutete Wirkung.
Arten von Hypothesen
Es gibt zwei Arten von Hypothesen: die gerichtete und die ungerichtete Hypothese.
Ungerichtete Hypothese
Bei der ungerichteten Hypothese bestätigst du zwar, dass es einen Zusammenhang gibt, allerdings stellst du keine Richtung fest.
Gerichtete Hypothese
Bei der gerichteten Hypothese hingegen gibst du diesem Zusammenhang eine Richtung, z. B. positiv oder negativ.
Gerichtete Hypothesen sind meistens sinnvoller für die wissenschaftliche Arbeit, denn sie sind aussagekräftiger und haben einen höheren empirischen Gehalt.
Eigene Hypothesen aufstellen
Möchtest du nun eigene Hypothesen für deine Untersuchung aufstellen, kannst du folgendermaßen vorgehen:
- Leite die Hypothesen von deiner Forschungsfrage ab.
- Begründe Hypothesen mithilfe deiner Literaturrecherche.
- Auch Alltagsbeobachtungen können zu Hypothesen führen.
Wichtig ist nur, beim Aufstellen von Hypothesen diese drei Kriterien im Kopf zu behalten:
- Die abhängigen und unabhängigen Variablen in deinen Hypothesen müssen messbar, also operationalisierbar, sein.
- Deine Hypothesen dürfen sich nicht widersprechen.
- Du musst auch in der Lage sein, deine Hypothesen zu widerlegen.
Hypothesen formulieren mit Beispielen
In der Regel sind Hypothesen in einem Konditionalsatz formuliert. Das beinhaltet Konstruktionen mit wenn X, dann Y oder auch je X, desto Y.
Hypothesen sind keine Fragen, sondern Aussagen. Versuche, sie so präzise wie möglich zu formulieren.
Testen von Hypothesen
Hast du deine Hypothesen aufgestellt, musst du diese nun testen und auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen.
- Wenn sich eine Erwartung bewahrheitet, kann die entsprechende Hypothese ‚verifiziert‘ werden.
- Bestätigt sich eine Erwartung hingegen nicht, wird die Hypothese, die sie ausdrückt, ‚falsifiziert‘.
Statistische Überprüfung der Hypothesen
Du hast die Möglichkeit, deine Hypothesen statistisch zu testen. Dafür stellst du eine Nullhypothese (H0) und eine Gegenhypothese (H1) auf.
Die Nullhypothese geht davon aus, dass kein Zusammenhang besteht und die Gegenhypothese soll geprüft werden. Dir stehen eine Reihe an statistischen Hypothesentests zur Verfügung, um die Hypothese zu verifizieren.
Hypothesentest durch Literatur
Es ist ebenfalls möglich, deine Hypothesen anhand deiner Literatur zu verifizieren. Schaue dir Studien zu diesem Thema an und fasse deine Ergebnisse zusammen.
Hypothesen in die Abschlussarbeit integrieren
Du kannst den Hypothesen ein eigenes Kapitel zu Beginn der Arbeit in der Einleitung zuweisen oder sie am Ende des Literature-Reviews erwähnen. Dort kannst du dann genauer darauf eingehen, wie du von der Literatur zu den Hypothesen gelangt bist.
Mithhilfe deiner Methodik überprüfst du die Hypothesen. Anschließend verifizierst oder falsifizierst du sie in deinem Ergebnisteil und/oder deiner Diskussion.
Diesen Scribbr-Artikel zitieren
Wenn du diese Quelle zitieren möchtest, kannst du die Quellenangabe kopieren und einfügen oder auf die Schaltfläche „Diesen Artikel zitieren“ klicken, um die Quellenangabe automatisch zu unserem kostenlosen Zitier-Generator hinzuzufügen.
Pfeiffer, F. (2021, 22. Februar). Hypothesen aufstellen mit Beispielen für die Abschlussarbeit. Scribbr. Abgerufen am 29. April 2024, von https://www.scribbr.de/methodik/hypothesen-formulieren/